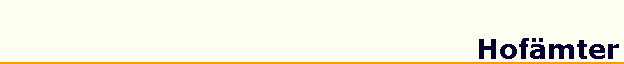|
|
 |
|
|
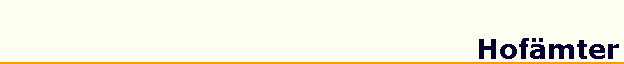 |
 |
 |
|
Im
Hochmittelalter war es üblich, daß jedes Fürstenhaus
Ämter zur Besorgung der Haushaltung hatte; die ursprünglichen
vier Hofämter waren Marschall (Stallmeister), Mundschenk (Aufseher
der königlichen Weinberge bzw. Weinkeller), Kämmerer
(Schatzmeister) und Truchseß (nordwestdeutsch meist: Droste;
Vorsteher der Hofverwaltung).
Im römisch-deutschen Reich gelangten diese Hofämter als
Reichserzämter zuerst an Stammesherzoge, dann erblich an
Reichsfürsten. Den mit dem Amt verbundenen Dienst übten die
Inhaber der Reichserbämter aus, wobei auch diese erblich wurden.
Daneben gab es noch in den verschiedensten Ländern derartige
Hofämter, mit denen ursprünglich Unfreie betraut wurden, die
im Laufe der Zeit in Macht und Ansehen stiegen. Sie behielten zwar
Titel und Würden, die Arbeit wurden aber durch untergeordnete
Organe versehen. Die Dienste erlangten den Charakter von Ehrendiensten
und wurden schließlich nur noch bei besonders feierlichen
Anlässen wie Erbhuldigungen ausgeübt. Weiters lösten
sich die Hofämter nach und nach von der Person des Fürsten
und verwandelten sich in Landes-Erbämter, die lehenbar wurden.
Die Anzahl der Erbämter wurde in manchen Ländern im Laufe der
Jahrhunderte immer mehr erhöht. So gab es in Österreich ob
und unter der Enns je 17 Erbämter. Das Amt des Kämmerers
wurde daneben im Laufe der Zeit auch zu einem unbesoldeten Ehrenamt,
das Zutritt zum Souverän verschaffte.
- Georg Duwe:
Erzkämmerer, Kammerherren und ihre Schlüssel, Osnabrück
1990
- Georg Freiherr v.
Frölichsthal: Die Landes-Erbämter in den
österreichischen Kronländern, in: Deutsches Adelsblatt 2000,
172ff
- Bernhard Gondorf:
Die alten Reichsämter, in: Herold, Vierteljahresschrift, Band 11
1984/86, 101ff
- Irmgard Latzke:
Hofamt, Erzamt und Erbamt, Frankfurt am Main 1970
- Wilhelm Pickl v.
Witkenberg/Franz Tippmann: Kämmerer-Almanach, 4. Auflage, Wien 1908
- Ivan Ritter v.
Zolger: Der Hofstaat des Hauses Österreich , Wien und Leipzig 1917
|
|